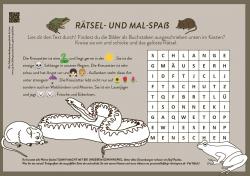Dem Geheimnis der Höllenottern auf der Spur
Student Vincent Kubach ist auf der Suche nach den dunklen Kreuzottern
Eintrag Nr. 40/2025
Datum: 02.10.2025
Frauenau. Wer eine weiße Maus mit roten Augen sieht, dem fällt sofort der Begriff „Albinismus“ ein. Das Fehlen des Pigments Melanin sorgt für ein helles Fell. Wenn ein Lebewesen zu viel Melanin produziert, tritt das Gegenteil ein: Haut und Augen werden dunkel. Genau diesem Phänomen ist der Student Vincent Kubach bei seiner Bachelorarbeit auf der Spur. Allerdings nicht bei Mäusen, sondern bei Kreuzottern.
Es ist früh am Morgen. Die Sonne schickt gerade ihre ersten Strahlen auf den Hochschachten, auf dem Vincent Kubach heute unterwegs ist. Nun ist die beste Zeit des Tages, um Kreuzottern zu finden. Die Reptilien nehmen ausgiebige Sonnenbäder. Zur Seite steht Vincent Kubach der niederbayerische Kreuzotterexperte Paul Hien. Er unterstützt den Biologie-Studenten nicht nur bei der praktischen Feldarbeit. Auch Hiens Datensatz mit über 500 Fotos von Kreuzottern, die in den Nationalparken Bayerischer Wald und Šumava sowie im Nationalparkvorfeld aufgenommen worden sind, bilden die Grundlage für die Arbeit des Nachwuchsforschers.
Dunkle Farbe hat wohl nichts mit besserer Wärmeaufnahme zu tun
An diesem Tag haben die beiden Glück. Tatsächlich liegt auf einem Wurzelstock eine Höllenotter. Die Kamera ist schnell gezückt, ein Foto aufgenommen. Wichtig ist, dass das Rückenband und der Körper gut zu erkennen sind, erklärt Hien und ergänzt: „Bis jetzt haben wir nur sehr wenige schwarze Kreuzottern auf einer Höhenlage von über 1000 Metern gefunden.“ Und allein mit dieser Erkenntnis bricht er mit der Hauptthese, die es bis dato zu diesem Thema gibt. „In der Literatur ist es gängige Meinung, dass Kreuzottern, die in höheren, kühleren Lagen leben, schwarz sind, damit sie die Sonne besser aufnehmen können und damit schneller warm werden.“ Die bisherigen Forschungen von Hien bestätigen dies jedoch in keinster Weise. „Im Nationalpark sind in den wärmeren Bereichen, in denen es auch Zauneidechsen gibt, die meisten Höllenottern – wie beispielsweise am Kolbersbach bei Lindberg.“ Doch wenn die Höhenlage keine Rolle spielt, was ist dann der Grund?
Vinzent Kubach hofft, dass er mit seiner Bachelorarbeit einen Beitrag leisten kann, um das Rätsel zu lösen. „Ich interessiere mich schon seit Langem für Reptilien“, berichtet Kubach. Das Thema hat er gemeinsam mit seinem Professor Jörg Müller erarbeitet, der nicht nur an der Universität Würzburg lehrt, sondern auch Forschungsleiter im Nationalpark ist. „Die Bedeutung der Kreuzotterpopulationen im Nationalpark waren mir bekannt, vor Ort war ich jedoch noch nie. Umso spannender waren die Tage, an denen ich draußen im Schutzgebiet unterwegs sein konnte.“
Konkrete Definiton für "Höllenotter" fehlt noch
Denn die meiste Zeit verbringt der gebürtige Rheingauer am Schreibtisch. Dort wertet er hunderte von Fotos aus, durchforstet die bereits bestehende Literatur und geht der Frage nach, wie eine Höllenotter aussehen soll. „In vielen bestehenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird dies nicht definiert“, erläutert Paul Hien. „Dabei ist es wesentlich, um präzise Aussagen treffen zu können.“ Muss alles an der Schlange schwarz sein? Zählt sie nur dann als Höllenotter? Wie darf das Rückenband aussehen? „Schwarz ist nicht einfach nur schwarz, da macht man es sich bei der Kreuzotter zu leicht“, so der Experte. Und alleine das zeigt, dass der Weg noch lang sein wird – bis das Geheimnis der schwarzen Kreuzottern gelöst ist.
Hinweis: Dieser Text stammt aus dem Nationalpark-Magazin "Unser wilder Wald", Ausgabe Herbst 2025. Auf unserer Homepage bieten wir das Magazin auch als PDF-Dokument an.